Worin besteht Sprachkritik: Richtet sie sich auf Grammatik und Vokabular und sonst nichts, oder muss sie die Sprache als Ausdruck fehlerhaften Denkens und einer defizitären Moral nehmen?
Es gab schon so unfassbar viele Sprachkritiker… Manche traten unter dem Banner der Grammatik an und beschwerten sich über überflüssige Fremdwörter und falsche Wortstellungen. Auch vermissten sie den Genitiv oder das Dativ-e.
Viele darunter waren einfach nur Zensuren verteilende Oberlehrer, wie zum Beispiel Gustav Wustmann, der Ende des 19. Jahrhunderts mit „Allerhand Sprachdummheiten“ Erfolge feierte – mein Exemplar hat das fünfte Zehntausend als Auflage, und damit hatte es noch kein Ende. Wustmann, seiner Erfolge ungeachtet, ist ganz und gar vergessen. Und mit Recht!
Die Bücher von Bastian Sick haben in den letzten zehn Jahren noch viel größere Auflagen als die „Sprachdummheiten“ erlebt. Aber bei dem vergessenen Gustav Wustmann wie bei Bastian Sick blieb es immer bei Sprachkritik – den Schwenk zur Moral (oder vielleicht besser: zu deren Kritik) haben beide nicht hinbekommen, obwohl besonders Wustmann anders als der ironisch angehauchte Sick doch die Grundvoraussetzung dafür mitbrachte, nämlich eine gehörige Portion schlechte Laune. Heute heben Kritiker dieser Art der Sprachkritik gerne hervor, dass das Abmeiern Sprachunbegabter oder Sprachunkundiger zur Hebung des bildungsbürgerlichen Selbstbewusstseins wie gerufen kommt. Man besucht mit ein paar hundert, wenn nicht gar tausend Gesinnungsgenossen eine Veranstaltung und darf sich hernach als Teil der Bildungselite fühlen.
Wir erinnern uns nicht an die Grammatiker, sie mochten Recht haben oder nicht; wir erinnern uns an die Moralisten und an ihre Kritik, denn so wichtig Grammatik und Wortschatz auch sein mögen, erst die Kritik am Denken gibt der Sprachkritik die rechte Würze. Deshalb gilt für die Großen unter den Sprachkritikern: Den erhobenen Zeigefinger, den polemischen Furor haben sie mit den Oberlehrern gemein, und wie diese über die Sprache sprechen, meinen aber doch etwas ganz anderes, das sich dahinter verbirgt. Mögen die Themen wechseln!
Heute ist Sprachkritik vielleicht zum ersten Mal allgemein geworden, schon lange nicht mehr die Sache von einigen wenigen, die sich mit Grammatik auskennen. Nur kommt es ihr nicht länger auf die Grammatik an – insofern trifft Sick bei sehr vielen keinesfalls auf Gegenliebe –, sondern allein auf die Wortwahl. Man muss und soll sich politisch korrekt äußern und Dinge und Menschen korrekt benennen, und wenn es gar nicht anders geht, gerne gegen alle Regeln. Wer das nicht tun mag, wird schief angesehen; und wer sich beleidigt fühlt, hat allemal recht.
Ging es vor Jahrzehnten um Spuren einer nationalsozialistischen Sprache, so demonstriert man heute also eine ostentative Aufmerksamkeit für die Belange von Menschen, die tatsächlich diskriminiert werden oder sich das eventuell auch nur einbilden. Der typische Sprachkritiker unserer Tage, der sich nicht anders als Wustmann aufführt – nämlich als Oberlehrer –, nimmt für sich eine Lebenseinstellung oder Sensibilität in Anspruch, die an die Stelle der Kompetenz eines Grammatikers getreten ist. Diese Sensibilität nennt sich „Wokeness“, und ihre daraus folgende Kritik gilt zunächst dem Verhalten, auch wenn sie immer am Vokabular ansetzt. Es ist ein ziemlich hohes Ross, auf das sich diese Kritiker damit setzen – aber Sprachkritiker waren schon immer so, nämlich ihrer Sache gewiss, selbst angesichts offensichtlicher Bildungslücken.
In diesem und in dem folgenden Beitrag sollen vier Sprachkritiker der Vergangenheit vorgestellt werden, deren Bücher zu lesen sich bis heute lohnt. Einer von denen war der FAZ-Redakteur Karl Korn (1908-1991). Korns schmaler Band ist ein schönes und bis heute lesenswertes Buch, das seine Qualität der jahrelangen Sammeltätigkeit eines ebenso kundigen wie sprachsensiblen Autors verdankt. Für jede seiner Thesen bringt er nicht nur ein oder zwei, sondern immer sehr viele Beispiele, und es ist zunächst ihre Fülle, die seine Argumentation so überzeugend sein lässt. Dazu belässt Korn es nicht beim Meckern, sondern analysiert die Beispiele und findet Begriffe, um seine Beobachtungen zusammenzufassen. Beispielsweise spricht er vom „seriellen Satz“ oder vom „Spiralstil“, und schon mit diesen Kategorisierungen geht seine Kritik weit darüber hinaus, nur schlechte Zensuren für Stil und Anstand zu verteilen. Korn war kein Oberlehrer wie Wustmann oder Sick, sondern vor allem ein guter und sensibler Beobachter, der über die Sprachkritik zu einem (vergleichsweise zurückhaltenden) Moralisten wurde. Besonders mag ich seine Anmerkungen über den Angeber und seine Sprache. Können sie noch heute Gültigkeit beanspruchen?
Karl Korn ist noch ganz von den zwanziger Jahren geprägt, als mehrere bedeutende Autoren unter dem Einfluss von Max Weber Idealtypen beschrieben. Weber selbst zeichnete „den“ kapitalistischen Unternehmer im Zeichen des Protestantismus, „den“ Berufspolitiker und „den“ Wissenschaftler. Unter seinem Einfluss beschrieben Siegfried Kracauer und Ernst Jünger „Die Angestellten“ (1930) und den „Arbeiter“ (1932), und schließlich kulminierte diese literarisch-soziologische Typologie in der bedeutendsten Studie dieser Art, in Hannah Arendts „Vita activa“ (1960). Auch Karl Korn beschreibt im „Angeber“ einen solchen Idealtypus, den er in seinem Jargon fassen möchte, nicht etwa in seinem großspurigen Auftreten. Besonders in diesem Kapitel geht sein Buch über bloße Sprachkritik weit hinaus und erfasst einen moralischen Typus.
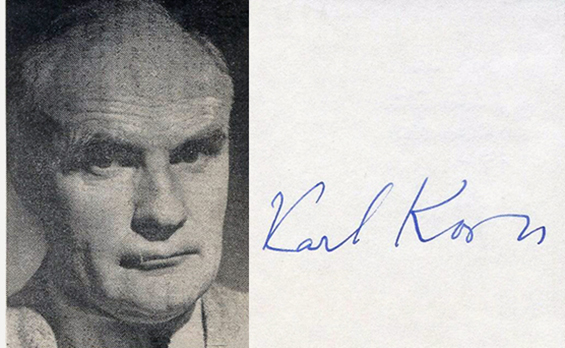
Zeitungsportraitausschnitt und Signatur Karl Korn (1908-1991). Abb.: Archiv
Mit dem Angeber führt Korn dem Leser „die halbabstrakte Sprache der Zeit, die Sprache des Betriebs, der Groschenzeitung vom Kiosk, der Rundfunkansager“ vor Augen. Es ist ein subalterner Sprachwitz, der in der Analyse Korns die Sprache der Landser (der einfachen Weltkriegssoldaten), der Angestellten und kleinbürgerlichen Arbeiter in einer Fülle von Beispielen prägt. Es handelt sich, schreibt Korn, um „die soziologisch schwer definierbare Schicht großstädtischer Menschen, die in der Siedlung leben, im Betrieb arbeiten, am Kiosk Zigaretten, Bier und Illustrierte kaufen, die sich dauerwellen lassen und deren Töchter es weit von sich weisen würden, Hausmädchen zu sein.“ Das klingt nicht nur snobistisch (und erinnert damit an Adorno, dem das Buch gut gefiel), es ist auch wirklich snobistisch. Nichtsdestotrotz traf diese Beschreibung wohl ziemlich ins Schwarze. Dabei war Korn dazu imstande, die Verfallenheit der Sprache an die Technik auf hohem Niveau zu reflektieren – auf einem höheren, als es dem arrivierten Philologen Victor Klemperer gelang: https://www.gleichsatz.de/b-u-t/begin/korn.html (Es handelt sich bei dem Text um einen klug ausgesuchten Auszug aus „Sprache in der verwalteten Welt“.)
Für uns heute sind Korns lebendige Beispiele interessant. Wer zum Beispiel hätte gedacht, dass „das ulkige Wort ‚verpassen‘ auf die Geschosse und Splitter des Gegners“ gemünzt war: „Wenn einer ‚ein Ding verpaßt kriegte, war er verwundet oder tot. Der bramarbasierende Stammtischangeber nennt Rüffel, die einer im Betrieb erhält, noch immer ‚verpaßte Dinger‘.“ Korn bringt dutzende, ja hunderte Beispiele dieser Art, bei denen sich der Leser nur wundern kann: Das hätte er niemals vermutet, dieser Ausdruck schien ihm doch ganz harmlos…
Sein Buch veröffentlichte Korn 1958, und die Mehrzahl seiner unzähligen Beispiele ist den Zeitungen oder der Literatur des 3. Reiches entnommen. Oder den Fünfzigern. So wird dieses Buch, so lesenswert es ist, für die Mehrzahl der heutigen Leser eine eher historische Bedeutung haben. Aber weil viele der von ihm kritisierten Phrasen und Wortwitze auch heute noch gebraucht werden, ist es nach wie vor ein echter Augenöffner.
Bereits zwölf Jahre vor Korns Buch erschien in der DDR Victor Klemperers „LTI“. Dieser Autor ist vielen Lesern bis heute bekannt, vor allem wohl, weil erst lange nach seinem Tod 1960 seine Tagebücher erschienen (ab 1986), aus denen er bereits ausführlich in seinem Buch zitiert. Anders als bei eigentlich allen anderen bedeutenden sprachkritischen Werken ist dieses Buch von biographischen Reminiszenzen durchsetzt, also besonders von den lebhaft geschilderten Erinnerungen des Autors an seine Begegnungen mit den Nationalsozialisten. Seine Kollegen an der Universität, Automechaniker, jugendliche Verwandte oder Freunde, die dem Nationalsozialismus verfielen: Sein Buch hat den Nationalsozialismus zum Thema und sonst nichts, und wenn er die Ideologie auch zunächst an der Sprache zu fassen bekommt, so bleibt es doch nicht bei deren Analyse. Ja, deren Analyse geht nicht einmal wirklich in die Tiefe, obwohl der Autor doch ein renommierter Philologe gewesen ist. Der sehr begabte Erzähler Klemperer ist ein Moralist, der das „Gift der LTI“ im Jargon und in den Phrasen des Nationalsozialismus aufsucht, aber es ebenso sehr im täglichen Leben oder in den Gesichtern seiner Mitmenschen findet. So ist das Buch als Sprachkritik bei weitem weniger ertragreich als das von Korn, als Zeitzeugnis aber umso bedeutender.
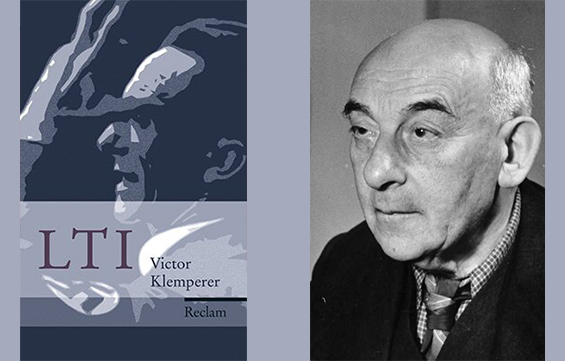
Links: Klemperer, Victor: LTI. Notizbuch eines Philologen © Reclam. Rechts: Victor Klemperer, 1952. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-16552-0002 / CC-BY-SA 3.0
Fragwürdig scheint mir seine Rezeption der Romantik, die er an verschiedenen Stellen als den Ursprung der nationalsozialistischen Ideologie haftbar macht. Klemperer glaubt einen „greifbaren Konnex zwischen nazistischem Verbrechertum […] und der früheren Geistigkeit Deutschlands“ gefunden zu haben, und an einer späteren Stelle schreckt er nicht einmal davor zurück, denselben Vorwurf gegenüber der Mystik Martin Bubers und Franz Rosenzweigs zu erheben, also gegenüber den beiden bedeutendsten jüdischen Intellektuellen der Zwanziger: „Romantik, nicht nur verkitschte, sondern auch echte, beherrscht die Zeit, und aus ihrem Quell schöpfen beide, die Unschuldigen und die Giftmischer, die Opfer und die Henker.“ Nach meiner Überzeugung ist das Unsinn.
Interessant für uns Heutige sind nicht zuletzt seine Bemerkungen über den Redner Adolf Hitler, den der Autor nur in den Wochenschauen des Kinos erlebt hat. Klemperer, vor seiner Universitätskarriere in Deutschland Lektor in Italien, vergleicht ihn mit Mussolini, der ihm als Redner deutlich begabter schien. Der „Duce“, so beschreibt ihn Klemperer, „schwamm doch immer im klingenden Strom seiner Muttersprache, überließ sich ihr bei allem Herrschaftsanspruch, war […] Redner ohne Verzerrtheit, ohne Krampf. Hitler dagegen“ – und das ist bis heute der vorherrschende Eindruck fast aller, die ihn hören und sehen – „Hitler sprach, vielmehr schrie immer krampfhaft […]. Nie war Gleichmut, nie Musikalität in seiner Stimme, in der Rhythmik seiner Sätze, immer nur ein rohes Aufpeitschen der anderen und seiner selbst.“ Klemperer spricht von „seiner unmelodischen und überschrieenen Stimme“ und geht mit dieser Beschreibung (wie ja auch sonst) über bloße Sprachkritik hinaus.
Seinem Buch verpasste der gelehrte Autor einen lateinischen Untertitel, denn „LTI“ ist eine „parodierende Spielerei“ und steht für „Lingua Tertii Imperii“ (die Sprache des 3. Reiches). In seinem Nachwort findet sich die Anekdote, wie ihm eine einfache Berlinerin erzählt, wie und warum sie ins Gefängnis kam. Sie hatte über Hitler gelästert und nannte als Haftgrund „wejen Ausdrücken“. Sie hatte wohl ganz passende „Ausdrücke“ für diese Leute gefunden…
Der Wortschatz ist Klemperers Thema. In seinem Buch werden Vokabular und die typischen Abkürzungen des Nationalsozialismus (deshalb „LTI“ – so ähnlich wie „HJ“ oder „BdM“) – dargestellt und analysiert, aber während das erstere sehr lebhaft daherkommt, geschieht das andere leider nicht auf einem sehr hohen Niveau. Der Abkürzungswahn zum Beispiel wird moniert, aber nicht, wie es Korn in dem oben verlinkten Kapitel plausibel gemacht hat, auf das technische Denken zurückgeführt. Für Klemperer glitt „der Nazismus […] in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang“. Anders als Korn, dessen Weste doch nicht so ganz blütenweiß war (denn ein klein wenig war er schon mitmarschiert), zählte der Jude Klemperer von Anfang an zu den Verfolgten jener Jahre, und kleine Geschichten und Anekdoten dieser Verfolgung und Drangsalierung durchziehen sein Buch von vorne bis hinten. Vor allem deshalb ist es bis heute eine wichtige Lektüre.
Hinweis: Die Inhalte der Kolumne geben die Meinung der jeweiligen Autoren wieder. Diese muss nicht im Einklang mit der Meinung der Redaktion stehen.
Teil 2 folgt am Do. 06.10.2022


Kommentar verfassen
(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)
Kommentare powered by CComment