Ist es denkbar, dass es Menschen gab oder gibt, die keinen Horizont kennen?
Die ihn nicht sehen, nicht wahrnehmen, die niemals bedenken, dass es hinter einer imaginären Linie weit draußen immer noch weitergeht? Die nicht realisieren, dass es dort hinten ganz anders aussehen könnte als bei ihnen? Oder zählt der Horizont zu den anthropologischen Konstanten, so dass ihn jeder Mensch kennen muss, so es sich wirklich um einen normalen und gesunden Menschen handelt?
Irgendwann in seiner Kindheit fängt der Mensch an, auch über Momente nachzudenken, die jenseits seiner unmittelbaren vitalen Interessen liegen – zum Beispiel darüber, was war, bevor er selbst in die Welt eintrat, oder über einen waagerechten Strich weit hinten, der Land und Himmel voneinander trennt. Haben Menschen anderer Kulturen den Horizont jemals anders als wir erlebt? Oswald Spengler hat im „Untergang des Abendlandes“ behauptet, dass es das „Tiefenerlebnis“ sei, das den europäischen Menschen (die „faustische Seele“) von früheren Menschen unterscheide, dass also der antike Mensch ebenso wie die „magische Seele“ (der Mensch der arabischen Kultur) noch keinen Horizont kannte. Ist das wirklich vorstellbar?
Für mich klingt es kaum glaubhaft, aber es ist unzweifelhaft wahr, dass die Kunst erst in der Renaissance den Blick in die Ferne entdeckte. Und damit wurde erst in jener Zeit der Horizont in das Bewusstsein gehoben. Im 1. Band des „Untergang des Abendlandes“ geht Spengler sogar noch einen Schritt weiter – diese der Malerei gewidmeten Passagen gehören zu den schönsten des Buches – und führt aus, dass die Kunst Rembrandts einige Zeit später (also hundert Jahre und mehr nach der Renaissance) dem Betrachter nur noch „Hintergründe“ bietet: „Man darf sagen, daß es in keinem Gemälde Rembrandts ein ‚vorn‘ gibt.“ Die Malerei vom 16. Jahrhundert an nennt Spengler „ins Unendliche schweifend“. Erst jetzt finde sich der Horizont auf den Gemälden.

Die Tiefe des Petersdoms in Rom. Foto: loveombra/pixabay
Spielt er auch heute noch eine Rolle? Sicherlich in Spielfilmen, aber auch in der bildenden Kunst? In seinem zweibändigen Werk „Ursprung und Gegenwart“ (1949/53) hat der Kulturphilosoph Jean Gebser zu zeigen versucht, dass in unseren Tagen die perspektivische Welt, die seit der Renaissance geherrscht habe, abgelöst werde durch eine aperspektivische Welt, deren Ausdruck er zunächst im Werk Paul Cézannes, dann aber in den kubistischen Bildern Georges Braques und Pablo Picassos wiederfand. Diesen Künstlern sei es darum gegangen, „die Illusion eines in einem unendlichen Raum sich vollziehenden dynamischen Vorganges zu erwecken“. Der dreidimensionale Raum, in dem wir leben und in dem wir uns orientieren, ist bereits in den Gemälden Cézannes kaum noch zu erkennen.
Wenn der Horizont wirklich nicht in heutigen Kunstwerken vorkommt: dürften spätere Menschen darauf schließen, dass wir Heutigen keinen Horizont kannten? Denn diesen Schluss zieht Spengler, wenn er auf vergangene Kunstepochen schaut. Man wird, sagt er (und damit hat er ganz gewiss recht), „weder im ägyptischen Relief noch im byzantinischen Mosaik noch auf antiken Vasenbildern und Fresken […] eine Andeutung des Horizontes finden.“ Auch nicht auf chinesischen oder japanischen Bildern, die oft geradezu unwirklich schön sind, aber eben keinen Horizont abbilden. Heißt das, dass diese Menschen – Europäer vor der Renaissance oder bedeutende fernöstliche Künstler – wirklich keinen Horizont sahen oder erlebten?

Japanische Ukiyo-e-Holzschnitte aus dem 18. Jahrhundert. Quelle: Library of Congress/unsplash
Der Mensch verfügt über Imagination, über die Fähigkeit, sich etwas bildhaft vorzustellen (vor Augen zu führen), das er nicht sehen kann. Sollte nicht zu jeder Einbildungskraft immer ein Horizont gehören? Ein Wesen mit Fantasie weiß, dass es noch weitergeht, dass es bei weitem nicht alles, was es gibt, sehen oder übersehen kann. Deshalb ist die Welt für den Menschen, wie Arnold Gehlen weiß, „ein Überraschungsfeld“, sogar ein „unendliches Überraschungsfeld“. Denn es gibt immer noch etwas, das er noch nicht gesehen, erlebt oder erfahren hat, nicht hinter jede Wand hat er geguckt, er weiß auch ganz prinzipiell um die Grenzen seiner Wahrnehmungen, und so bleibt, in den Worten Doderers, ein „braun-grüner Streif der Ferne“ immer in den Augenwinkeln des Ritters, der in der Erzählung „Das letzte Abenteuer“ einen tiefen Wald durchreitet; soweit sich der Wald auch erstrecken mag, der Ritter vergisst nie, dass es noch etwas hinter seinen Stämmen gibt, und wirklich scheint ja immer wieder die blaue Ferne in die Dämmerung herein.
Welche Bilder hat man vor Augen, wenn man an die Ferne in Bildwerken der Renaissance denkt? Sehr viele werden an den bläulich-blassen Hintergrund der „Mona Lisa“ denken, andere an die Bildwerke Albrecht Altdorfers, besonders an seine „Alexanderschlacht“ (1528/29). Dieses Bild greift als einziges großes Werk des Meisters ein antikes Thema auf und präsentiert es auf eine geradezu ungeheuerliche Weise. Es stellt dem Betrachter nicht weniger als den gesamten Mittelmeerraum vor Augen! Deshalb konnte Friedrich Schlegel 1803 davon sprechen, dass „die Aussicht im Hintergrunde […] ins ganz Unermeßliche“ führe. Vielleicht mehr als jedes andere Bild sonst kann es den Anspruch erheben, eine weltgeschichtliche Perspektive zu visualisieren – gar nicht einmal deshalb, weil es mit der Schlacht bei Issos ein epochales Ereignis darstellt, sondern wegen des ungeheuren Raumes, den es eröffnet, der fantastischen Weite, in die es uns schauen lässt, der Tiefe der Zeit, die wir dank seiner erahnen.

Albrecht Altdorfer (1480-1538): Alexanderschlacht (Schlacht bei Issus), 1529, 158,4x120,3cm. Alte Pinakothek. Quelle: Google Arts & Culture.
Kann man sehen, dass der Schöpfer dieses Bildes unmöglich unser Zeitgenosse sein kann? Denn wer würde heute das Erdenrund in dieser Weise abbilden? Immerhin hat Altdorfer den Horizont gebogen dargestellt… Wir wissen heute, wie man aus großer Höhe, ja aus dem Weltall auf die Erde schaut, und so weiß eigentlich jeder, dass es in Wahrheit trotz vieles Richtigen ganz anders aussieht als auf dem Bild des gut informierten Malers Albrecht Altdorfer. Wahrscheinlich ließ er sich von verschiedenen Gelehrten beraten, als er dieses Historienbild schuf, und ganz gewiss befand er sich auf der Höhe seiner Zeit.
Auf kaum ein anderes Gemälde, schreibt der Kunsthistoriker Andreas Pater, „trifft die Bezeichnung ‚Weltlandschaft‘ in solch grandioser Weise“ zu wie auf dieses Gemälde.“ Aber was bedeutet eigentlich „Welt“? Dieser Begriff zielt nicht einfach auf alles, was ist, sondern er ist nur der eine Pol einer Relation. Er bedeutet nicht einfach nur Sein, sondern das am Sein, was einem Menschen begegnet. Die um einen Kern herumsausenden Elektronen zum Beispiel gehören erst dann zu der Welt eines Menschen, wenn dieser davon erfahren hat.
Was Welt ist, lässt sich auf einem Umweg erläutern, über einen Irrtum, der einem Schachspieler unterlief, der einen Kampfnamen für das Internet suchte. Der sehr defensiv eingestellte Herr nannte sich „Werwolf“, als handle es sich hierbei um ein Tier, das sich zu wehren verstehe. Aber leider hat der erste Bestandteil des Namens nicht das Geringste mit Verteidigungskünsten zu tun, sondern bedeutet einfach nur Mensch. Der Werwolf ist ein Mensch, der sich nächtlich in einen Wolf verwandelt.
„Wer“ taucht noch in ganz anderen Wörtern auf, interessanterweise vor allem in „Welt“; das R, das manchen irritieren mag, findet sich im Englischen und dominiert dazu die schwedische („värld“) Variante des Wortes entgegen ihrer Schreibweise. „Das Bestimmungswort“, erläutert mein etymologisches Wörterbuch, „ist das gemeingermanische Substantiv ahd. wer […] altisländisch verr ‚Mann, Mensch‘, das auch als erster Bestandteil in Welt steckt.“ Auch findet es sich in dem lateinischen „vir“, wo es einfach nur „Mann“ bedeutet.
Mensch und Welt gehören zusammen, denn allein der Mensch hat Welt und lebt in einer solchen. Tiere dagegen leben in einer Umwelt. Nicht mehr als eine Umwelt zu besitzen bedeutet, dass alles nur auf das Tier selbst bezogen ist und nichts in seiner Umgebung ein Eigenrecht besitzt, eine Existenz oder Geltung außerhalb dieser Umwelt beziehungsweise unabhängig von ihr. In „Die Herrschaft des Leviathan“ macht Franz Vonessen darauf aufmerksam, dass der Begriff die Übersetzung des französischen „Milieu“ ist – und dieses Wort bedeutet einfach nur „die Mitte“. Im Spanischen verhält es sich übrigens ähnlich – dort heißt es dann „medio ambiente“. Wem es um die Umwelt zu tun ist, der setzt sich selbst in die Mitte, und damit geht es ihm allein um sich selbst. „Die Welt gibt dem Menschen die Mitte, das Mit-einander, hingegen in der Umwelt setzt der Mensch sich selbst als Mitte“, schreibt Franz Vonessen. Sich selbst in der Mitte zu sehen, bedeutet, sich auf einen animalischen Status zurückzusetzen und alles auf sich selbst zu beziehen, und die Kritik an der Vorherrschaft dieses Begriffes ist fast notwendig eine moralische. Wem es als Mensch nur um die Umwelt zu tun ist, der denkt eigentlich an sein eigenes Wohlergehen und an wenig sonst.
Der Begriff der Umwelt geht auf den Zoologen Jakob Johann Uexküll (1864-1944) und sein Werk „Umwelt und Innenwelt der Tiere“ (1909) zurück. Zusätzlich zu der Unterscheidung von Welt und Umwelt führt er noch die Unterscheidung von Merk- und Wirkwelt ein, die sich selbst erklärt, wenn man bedenkt, dass sie ganz vom Lebewesen aus gesehen ist. In einem sehr späten, seine jahrzehntelangen Forschungen zusammenfassenden Buch („Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen“, 1956) schreibt er plastisch: „Jedes Subjekt spinnt seine Beziehungen wie die Fäden einer Spinne zu bestimmten Eigenschaften der Dinge und verwebt sie zu einem festen Netz, das sein Dasein trägt.“ Seine Unterscheidung von Welt und Umwelt wurde von fast allen bedeutenden Philosophen der Natur übernommen, zum Beispiel von Helmuth Plessner („Die Stufen des Organischen und der Mensch“, 1928), Max Scheler („Die Stellung des Menschen im Kosmos“, 1928) und Arnold Gehlen („Der Mensch“, 1940). Es ist der Grundgedanke der philosophischen Anthropologie.

Neue Umwelt: Überdachte Landwirtschaft und Vertical Farming. Foto: Richard/unsplash
Der Mensch weiß anders als das Tier, dass er selbst nicht die Mitte einer Welt bedeutet, und deshalb fasst Plessner das Weltverhältnis des Menschen in den „Stufen des Organischen“ unter dem Stichwort „exzentrische Positionalität“ zusammen. Das bedeutet nicht mehr, als dass der Mensch sich selbst gedanklich an die Peripherie versetzen und von außen auf sich sehen kann. Als Folge weiß er sich selbst einzuordnen. Kein Tier ist dazu imstande.
Dem Tier tritt kein anderes Wesen für sich mit einer Welt entgegen, kein anderes Lebewesen besitzt für ihn ein eigenes Recht, und kein Ding wird unter rein sachlichen Gesichtspunkten betrachtet. Vielmehr wird alles Lebendige nur in Bezug auf sich selbst wahrgenommen; auch der Lebenspartner des Tieres, seine Konkurrenten oder seine Fressfeinde sind nichts als Teil seiner Umwelt; alles ist allein für die Kreatur, die im Zentrum dieser Umwelt steht. Deshalb ist das Tier, wie es Helmuth Plessner ausgedrückt hat, von einem „Mangel echter Dinglichkeit“ gezeichnet. Regenwürmer, so Plessner, begegnen allein „Regenwurmdingen“, wogegen die „Libelle nur von Libellendingen umgeben“ ist. Und Arnold Gehlen zeigt in „Der Mensch“, dass nicht einmal Schimpansen einen Sinn für Kausalität besitzen. Auch sie (selbst sie, die doch unsere Vettern sein sollen) können keine Fragen stellen, insbesondere „nicht nach dem Warum“.
Dagegen ist der Mensch, weil er nach Gründen zu fragen versteht, immer dabei, seine Grenzen zu überschreiten; indem er sich in seiner Umgebung umsieht, indem denkt, sucht und forscht, aber auch, indem er handelt, ja vielleicht besonders dann. „Handeln“, schreibt Hannah Arendt in „Vita activa“, „ist das ausschließliche Vorrecht des Menschen, weder Tier noch Gott sind des Handelns fähig, und nur das Handeln kann als Tätigkeit überhaupt nicht zum Zuge kommen ohne die ständige Anwesenheit einer Mitwelt.“ Denn der Mensch ist nie wirklich allein, sondern immer Teil einer Gemeinschaft, in seinem Denken wie in seinem Handeln. Wenn Arendt recht hat, dann ist jede Welt eine Mitwelt.
Die drei menschlichen Tätigkeiten, die Arendt in ihrem Buch behandelt, sind das Arbeiten, das niemals an ein Ende kommt, sondern stets von Neuem begonnen werden muss, das Herstellen, das beendet ist, wenn etwas fertig auf dem Tisch liegt, und schließlich das Handeln. Dieses allein zeichnet sich durch die Unabsehbarkeit seiner Konsequenzen aus, dadurch, dass es immer wieder in neue Welten vorstößt und Horizonte überwindet. Und wie der Widerstreit der Begriffe von Welt und Umwelt, so hat auch das eine moralische Dimension, denn Menschen, so schreibt Arendt (und man erfährt diese einfache Wahrheit immer wieder von Neuem…), „sind offenbar schlechterdings unfähig, die Prozesse, die sie durch ihr Handeln in die Welt loslassen, wieder rückgängig zu machen oder auch nur eine verläßliche Kontrolle über sie zu gewinnen.“
Den Unterschied zwischen Welt und Umwelt erläutert der Autor dieses Artikels auch in seinem Buch „Glanz und Elend der Philosophie“, erschienen im Verlag: Der blaue Reiter.

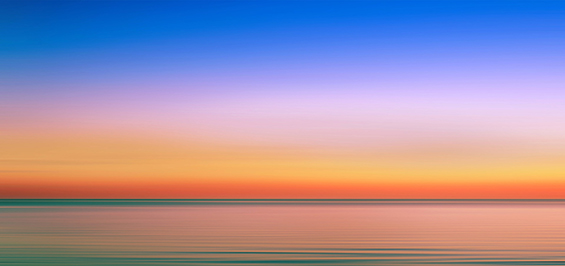
Kommentar verfassen
(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)
Kommentare powered by CComment