
Darf man das Theater hassen? Ja, sagt Jan Küveler, weil es zugleich arrogant und feige ist, weil es langweilt oder nervt, weil es selbstgefällig und verlogen ist. Der Theaterfeuilletonist von „Welt“ und „Welt am Sonntag“ rechnet ab, mit der Institution und ihren Mechanismen, mit lauwarmen Inszenierungen, größenwahnsinnigen Intendanten, schlechten Schauspielern und einem spießbürgerlichen Publikum.
Von zehn besuchten Theaterstücken, so die persönliche Statistik von Theaterrezensent Jan Küveler, sind vielleicht zwei oder drei gut, eines möglicherweise sogar richtig klasse. Und der Rest? Ärgerlich, überflüssig, läppisch, blutleer – kurz: diese Aufführungen zeigen uns, warum das Theater auch hassenswert schlecht sein kann.
In der deutschsprachigen Szene sei das hassenswerte Theater sogar eher die Regel als die Ausnahme, findet Küveler. Die immer gleichen Regisseure spielen Bäumchen-wechsel-dich auf den wenigen großen Bühnen des Landes; die Inszenierungen sind entweder marktschreierisch politisch, bemüht intellektuell oder enervierend experimentell; kümmerliche Ideen werden mit bildgewaltigem Effektgewitter aufgeplustert; eine selbstgefällige Szene versteckt sich hinter dem – institutionalisiert zugestandenen – Deckmantel der hohen Bildungsbürgerkunst; und das elitäre Theaterpublikum unterhält sich anschließend angestrengt geistreich zwischen Weinbar und Brezelstand.
Das reicht doch nicht! findet der „Welt“-Redakteur. Mit seinem Buch, das vor dem titelgebenden Kalauer „Theater hassen. Eine dramatische Beziehung“ nicht zurückschreckt, setzt Küveler zur Gegenwehr an, und versucht sich an einer Polemik auf die deutschsprachige Theaterszene, die kapitelweise durchexerziert, was da gegenwärtig alles so schiefläuft in der heutigen Theaterlandschaft. Damit das Theater bleiben kann, wie es war, muss es sich ändern, so schickt es der Klappentext des Buchs appellartig voraus.
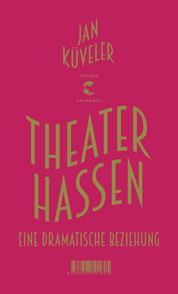 Entstanden ist eine 160-seitige Abhandlung, die zwei bis drei Abende Bettlektüre locker zu füllen vermag. Der Text ist erfrischend kurzweilig, unterhaltsam und anekdotenreich geschrieben, zumal der Autor seine Eigenbeobachtungen und -urteile mit amüsanten Begebenheiten der Theaterszene unterfüttert und die vereinzelten philosophischen und theaterhistorischen Exkurse durch popkulturelle Referenzen aufzulockern weiß. Dem teilweise recht sprunghaften Gedankengang des Autors steht die sorgsam sortierte Argumentkette der Kapitelgliederung gegenüber, die in bewusst provokant formulierten Thesen darlegt, wie der ausgeschriebene Theaterhass zu begründen sei: durch Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn der Beteiligten, durch das Genervtsein des Publikums, durch die Feigheit und damit eigenständige Verharmlosung des Dargebotenen, und nicht zuletzt, weil Küveler sich durch den wortreich ausformulierten Hass erhofft das loszurütteln, was das Theater erst zu diesem „Geisterhaus toter Avantgarden“ hat werden lassen.
Entstanden ist eine 160-seitige Abhandlung, die zwei bis drei Abende Bettlektüre locker zu füllen vermag. Der Text ist erfrischend kurzweilig, unterhaltsam und anekdotenreich geschrieben, zumal der Autor seine Eigenbeobachtungen und -urteile mit amüsanten Begebenheiten der Theaterszene unterfüttert und die vereinzelten philosophischen und theaterhistorischen Exkurse durch popkulturelle Referenzen aufzulockern weiß. Dem teilweise recht sprunghaften Gedankengang des Autors steht die sorgsam sortierte Argumentkette der Kapitelgliederung gegenüber, die in bewusst provokant formulierten Thesen darlegt, wie der ausgeschriebene Theaterhass zu begründen sei: durch Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn der Beteiligten, durch das Genervtsein des Publikums, durch die Feigheit und damit eigenständige Verharmlosung des Dargebotenen, und nicht zuletzt, weil Küveler sich durch den wortreich ausformulierten Hass erhofft das loszurütteln, was das Theater erst zu diesem „Geisterhaus toter Avantgarden“ hat werden lassen.Dabei bedient sich „Theater hassen“ zur Illustrierung seiner Kritik vor allem bei den prominenten Namen der Szene: Frank Castorf mit seinem „größenwahnsinniges Erschöpfungstheater“ kann Küveler noch einiges an Faszination abgewinnen, Michael Thalheimers einschläfernden, da immer gleichen und zunehmend manierierteren Inszenierungen dagegen seien nur noch „vorhersehbar und deshalb langweilig“. Die Selbststilisierung von Regisseurin Andrea Breth verurteilt Küveler als einfältig und arrogant, bei Herbert Fritsch könne man dagegen „lachen wie bei niemandem sonst“.
Einen klitzekleinen Aufschrei provozierte Küveler mit seiner Kritik an den Elfriede Jelinek-Inszenierungen. Nicht nur, dass er deren überbordenden Texten vorwirft, sie hätten „keine Handlung, kein Spannungsbogen […] Alles suppt ineinander“. Auch das vermeintliche Erfolgsrezept der Autorin nimmt Küveler in seinem Buch auseinander: Erst würde sich Jelinek das je aktuelle Brennpunktthema der Stunde vornehmen (Finanzkrise, Flüchtlinge), dieses mit Klassikerbezügen (Heidegger, Rilke) vermischen und ansonsten „sämtliche Klischees, Allgemeinplätze, Gehässigkeiten und Dummheiten“ zusammenrühren, die das Thema anbiete. Besonders schlimm sei dies bei dem am Hamburger Thalia-Theater aufgeführten Stück „Die Schutzbefohlenen“ gewesen, wo echte Flüchtlinge dann für den „Agitprop-Zirkus“ hätten herhalten müssen, dessen moralischer Zeigefinger gleichsam das ‚Gut‘ und ‚Böse‘ fein säuberlich fürs Publikum vorsortiere.
Dagegen lobt Küveler das politische Theater von Milo Rau, dem es mit seinen Stücken zum Kongo-Tribunal oder dem Völkermord in Ruanda gelinge, den Schrecken des fernab Geschehenden hautnah an den Zuschauer heranzuführen und dabei die Komplexität in den Abgründen der menschlichen Natur so einzufangen, dass selbst „den Bösesten der Bösen“ noch Ambivalenzen zugestanden werden.
Für seine Jelinek-Kritik wie auch für die wiederholte Abrechnung mit dem Wiener Burgtheater, die das Buch durchzieht, musste sich Küveler auf der eigenen Buchpräsentation von Gast David Schalko vorwerfen lassen, die Passagen seien allzu „zynisch“. Vielleicht wurde so auch schon der Grundtenor gesetzt, warum das Buch „Theater hassen“ in der deutschen Presselandschaft bislang auf keine allzu große Begeisterung stieß: Matthias Dell (Deutschlandradio Kultur) spricht vom „impressionistischen Geschnösel eines wenig originellen Ichs“, Christine Dössel (Süddeutsche Zeitung) noch deutlicher vom „solipsistischen Aufwasch und Genörgel“, und Katrin Bettina Müller (taz) wirft dem Autor vor, er schäme sich „für das Bürgerliche seines Berufs“ in seinem Bemühen „Hochkultur machen, aber es nicht so aussehen lassen.“
Tatsächlich nervt Küvelers Schreibe an einigen Stellen ganz gewaltig, vor allem mit den popkulturellen Anbiederungen an den Leser. Da wird dann die „Downtown-Abbyeisierung“ des Theaters beklagt, das Wechselspiel der Intendanten und Schauspieler ist erst per platter Fußballmannschaft-Metapher verdeutlicht, und was Katharsis heißt, so kokettiert der Autor, müsse man angeblich erst einmal auf dem Smartphone nachschauen. Wenn auf der einen Seite noch Exkurse zu Baudrillard und Badiou vorgenommen werden, muss das Probenkonzept von René Pollesch eine knappe Seite später den Dschungelcamp-Vergleich ertragen. Und natürlich darf auch ein Theaterkritiker eine Erfolgsserie „True Detective“ toll finden, sie gegen die Inszenierung von „Diese Geschichte von Ihnen“ (Barth 2016) aufzurechnen, ist aber einfach zu billig – und verwischt die eigentlich sonst oft berechtigte Kritik des Autors unnötig.
Hass, das sei nichts als eine Liebe, die knapp danebengeht, so schreibt Jan Küveler. Dass er sich immer wieder an seinem Gegenstand, dem Theater, aufreibt und abarbeitet, wird mehr als deutlich, und dass sich dahinter natürlich eine tiefe Zuneigung dem Gegenstand gegenüber verbirgt, bleibt natürlich kein Geheimnis. Das Buch „Theater hassen“ speist sich aus dem gut informierten (Insider-)Wissen des Autors, mit dem er sich als Kenner der Theaterszene outet, verkauft sich aber in seiner Kritik dann aber doch immer wieder zugunsten eines redundanten Zirkulierens um aufgestellte Behauptungen und allzu dünner Aha-Effekte aus dem Popkulturellen. Damit kann das Buch sicher diejenigen Leser abholen, die eher selten ins Theater gehen, für den einigermaßen informierten Theaterbesucher schießt das Buch aber eben leider auch „knapp daneben“.
Jan Küveler: Theater hassen. Eine dramatische Beziehung.
[Tropen Sachbuch]. Stuttgart: Klett-Cotta, 2016.
ISBN: 978-3-608-50160-5; 12 Euro.
Leseprobe
Abbildungsnachweis:
Header: Innenraum Deutsches Schauspielhaus. Foto: Lothar Braun
Buchumschlag